Antonín Dvořáks Rusalka feiert erfolgreich Premiere – mit deftigen Buhs. Kornél Mundruczó, dessen Sleepless-Inszenierung am selben Ort ganz nett war, gelingt ein beflügelt krasses Regiewerk. Die Sänger – sind erstklassig.
Das ist das Fazit.
Die Erfolgsoper Rusalka trägt die Genrebezeichnung Lyrisches Märchen. Der Stoff – Hexen, die Zaubersud brauen, Nixenromantik – war im Uraufführungsjahr 1901 schon verstaubt, ein Jahr zuvor erblickte der Psychothriller Tosca das Licht der Opernwelt. Aber Dvořáks Musik ist tiefgründig und dramatisch, psychologisch feinfühlig und wunderbar eingängig. Monika Pormale baut ein hyperrealistisches Bühnenbild. Rechts ein Berliner Altbautreppenhaus, links eine pittoresk versiffte WG, in der die Elfen und der Wassermann mit Rusalka hausen.

Ein Stock drüber logiert der Prinz im Dachgeschoss-Loft mit nervtötend schicker Familie, an der Wand hängt ein echter Bisky. Rusalka ist ein schräges, schwer verpeiltes Gothic-Girl. Die Elfen figurieren als Partymädls. Der Wassermann ist ein strubbelhaariger, sympathischer Hüne, der verkatert am Küchentisch hängt. Die Hexe Ježibaba ist die Nachbarin von nebenan. Der Prinz ein empfindsamer, mit Tapered Cut und Vokuhila modisch urbaner junger Mann.
Rusalka – schmal, blass, kompliziert, sensitiv – taucht am liebsten liebeskrank in der Badwanne ab. Denn sie hat sich ausgerechnet in den androgynen Schönling vom Stock drüber verguckt, Christiane Karg singt das fesselnd, nuancenfein, liedhaft genau, öffnet den kostbaren Vokalfarbenfächer – nur beim berühmten Lied an den Mond fehlt das mitreißende Dahinströmen. Mundruczó inszeniert völlig romantikfrei: Rusalka kehrt als labiles Wrack aus der falschen Menschenwelt wieder.

Die wiedererlangte Sprachfähigkeit muss sie gegen einen monströsen, schwarzglänzenden, eklig hässlichen, mühsam hinter sich herzuschleppenden Wurmschwanz eintauschen. Da kippt die Geschichte an der Staatsoper Berlin ins Chiffriert-Symbolistische. Aber nur kurz. Denn als Kontrapunkt dazu fährt die Story per Hebebühne zum Finale ins dämmrige Kellergeschoss, wo der erlösende Kuss den Liebsten tötet und die letzten Minuten der Oper zu den spannendsten zählen, weil total offen ist, was passiert.
Gesungen wird stark. Pavel Černoch ist ein Parade-Prinz, tenoral schlank und fest, und wunderschön timbriert, besser gehts nicht, Mika Kares stellt einen machtvollen Wassermann dar, einen schluffigen WG-Oldie mit rächend bedrohlichem Auftritt im Finale. Die Ježibaba verkörpert Anna Kissjudit darstellerisch furios und stimmlich eindrucksvoll als herzhaft extrovertierte Hexe. Die Fürstin gibt Anna Samuil als sinnlich brodelndes blondes Gift. Adam Kutny ist ein souveräner Heger, ein vitaler Küchenjunge ist die heftig schön singende Clara Nadeshdin, für die fröhlichen Elfen geben Regina Koncz, Rebecka Wallroth und Ekaterina Chayka-Rubinstein ihr Sopran- bzw. Mezzo-Bestes. Der gute Jäger ist Taehan Kim.
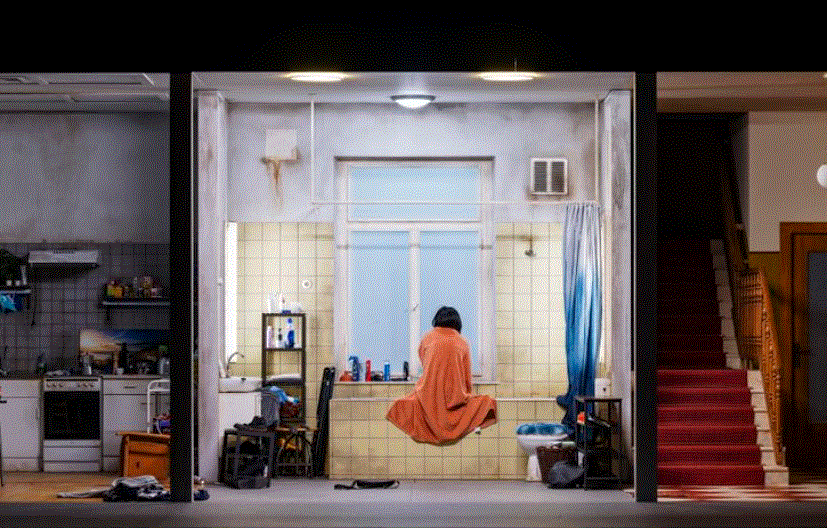
Am Pult überrascht Robin Ticciati, Noch-Chef beim hiesigen DSO. Unter Ticciati klingt die Staatskapelle frisch, klar, biegsam, dazu rhythmisch präsent wie selten und obendrein farbschön und transparent in Bläsern und Streichern. Leise kann Ticciati auch. Was will man mehr? Ein vollgültiger, sinnlicher Dvořák im warm durchleuchteten, nie grellen, noch dazu durchhörbar modernen Staatskapellenklang.
Die Kritik? Rusalka in Berlin ist ein bildstarker, fabelhaft krass erzählter Opernabend, in jeder Minute unterhaltsam, dabei exzellent musiziert.
Heftige Buhs nach dem ersten Akt und beim Schlussapplaus. Sonst viel Beifall.
Weitere Premierenkritik Rusalka: „Zickige Buhs“ (Kai Luehrs-Kaiser)

ok, hab den Janacek als tschechischen Opernkomponisten ganz vergessen. Aber weil ich ihn nicht verstehe, zählt er nicht.
LikeLike
Wie auch immer. Die Rusalka ist eine der besten 20 Opern der Welt, darüber kann es keine Diskussion geben. Nur weil die Sprache so schwer ist, wird sie viel zu selten aufgeführt.
LikeLike
Bin gespannt, wo Ticciati als nächster Trainer wirken wird. Wird schon ’ne große Nummer sein.
LikeLike
Also zur Rusalka kann ich nur sagen : wenn ich nicht so schrecklich erkältet wäre, würde ich gleich nochmal in die Derniere gehen. Aber so würde ich nur die Vorstellung zerhusten.
Exzellente, am Text orientierte, und witzige, tiefgründige Inszenierung mit viel Wärme und Lyrik aus dem Graben. Warum die (großartige) Rusalka ganz am Anfang nicht dahinströmen kann, sondern nur am Ende, das wird ja ganz klar gemacht.
Auffallend leider, daß das Publikum den Tenor nicht würdigte. Der war der einzige, der verstand und fühlte, was er da sang, die anderen sangen nur Buchstaben. Meine Oma aus Preßburg hätte über Cernoch gesagt : so geheert sich das. Der war fast ebenso großartig wie seine Aalkollegin.
Mein Sohn fragte hinterher : war das so gut wie auf Platte ? Nein, besser, weil alle Nebenrollen gut besetzt waren und die Inszenierung fast alles erklärt. Was kann man mehr wollen.
LikeLike
Die letzten Minuten sind eigentlich sowas wie Wagners Liebestod, nur auf tschechisch. Im Chenier gibts das auf italienisch.
LikeLike
Gioconda in der DOB war mal wieder ein großes Vergnügen :-)
LikeLike
Wie war cielo e mar? Ich mag ja italienische Stimmen fast immer, aber bin wegen dem Villari (und ein paar anderen Besetzungsdetails) dann nicht gegangen.
LikeLike
Also, wie ich eigentlich denke: Berlin wird dargestellt, hässlich, verrückt, unaesthetisch, es kann ja eigentlich nicht anders enden als so
LikeLike
Genial. Höre seit Kurzem die hypermega Spohrkonzerte mit Hoelscher/Fröhlich mit dem Berliner Ost-RSO, und auf Van spricht Stefan Lang, der damals daran beteiligt war. https://van-magazin.de/mag/stefan-lang-kulturradio/
Und guter Hinweis auf Josef Labor und seine drei Klavierkonzerte. Spannendes Gespräch
LikeLike
Ich spiel jetzt grade das letzte Präludium in h moll aus dem Wohltemperierten, weil es so schön ist. Ein bißchen melancholisch, wie alle Stücke in moll, aber dafür sind sie ja da. Und harmonisch ziemlich komplex.
Als ich damit halb fertig war, dachte ich: irgendwoher kenne ich diese Harmonien. Um es kurz zu machen : ich glaube, die Geharnischten- Szene in der Zauberflöte ist von Bachs Präludium inspiriert. Dieselbe Basslinie, ähnliche Harmonien, und dann der Choral darübergelegt. Mozart war 1789 in Leipzig und hat da mit einem andren Liebhaber Bachwerke studiert.
Er hat dann dort als Reaktion auf die Zwölftonfuge nach dem Präludium eine Gigue geschrieben, die so genial wie unmozartisch klingt (KV 574). Als ich das Präludium spielte, dachte ich : das kenn ich doch? Ich glaube, 2 Jahre später hat er dieses letzte Präludium zum Vorbild für die Begleitung genommen für : „Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden, wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erden.“
LikeLike
Ganz am Schluß liegt der Hase im Pfeffer : diese Szene mit der Flöte über den paar Akkorden ist für gewöhnlich die langweiligste der ganzen Oper. Ich habe mich immer gefragt, warum der Mozart da so einen trägen, dürren Mist komponiert hat.
Aber das ganze ist ein leichter barocker Tanz! Pablo Heras Casado hat das mit dem Freiburger Barockorchester in Aix en Provence völlig klar gemacht.
Die Musikwissenschaftler sollen herausfinden, welche Form das ist, Polonaise, Sarabande oder weiss ich was. Wahrscheinlich haben sie es längst. Wichtig wäre, dass den Dirigenten in der Ausbildung gezeigt würde, was das eigentlich ist.
LikeLike
Ein Hoch auf das deutsche Feuilleton. Die ersten sieben Artikel, wenn man auf Spiegel/Kultur ist (Untertitel: „Rezensionen, Nachrichten und Analysen aus Kultur und Gesellschaft“):
„Dschungelcamp, Tag 13: Schluss mit der kalbsäugigen Paarverklärung“, „Erst Kamel-Anus und Mäuseschwanzpüree“, „H. Hoenig verlässt Dschungelcamp“, „Heiliger Bimbam, ich krieg das nicht auf“, „Hätte, hätte, Koala-Rosette“, „Ich hab noch eine Vagina, Heinz“, „Mit der ‚Pussy‘ ins Gesicht“.
Da braucht man sich nicht wundern, dass die wichtigeren deutschen Orchester eher nicht aus Hamburg kommen.
LikeLike
Ausserdem müssen Sie mal die göttlichen Kommentare von Marie von den Benken in der FAZ zum Dschungelcamp lesen. Wenn Sie so einen zur Oper hinbekommen, wären Sie der König der Kritiker!
LikeLike
Cernoch ist der Prinz vom Dienst, sagte der Dramaturg am Sonntag in der Matinee. Der könnte kaum was andres singen, wenn er wollte. Aber was ist eigentlich mit Pavol Breslik ? Der müßte das auch können. Und in 5-10 Jahren möchte ich Slavka Zamecnikova aus Preßburg in der Rolle sehen. Die müßte das eigentlich mit echter slawischer Lyrik hinkriegen.
LikeLike
Hab ich auch so gehört bei Karg was KLK schreibt. Ist ja kein Zufall, Karg war ja damals, mitten im gerade beginnenden Corona-Chaos, so ziemlich die beste Micaela jemals.
LikeLike
Also sie war gut, aber die beste jemals ? Nee. Wir waren in der letzten Vorstellung vor dem ersten Lockdown, wo Barenboim sich am Ende für die jahrelange Treue bedankte, als wolle er sagen, es geht nicht mehr lang weiter. Nehmen wir mal Barbara Hendricks. Oder Helen Donath. Eine gute Micaela ist ein liebes Mädel vom Lande, und das war Karg nun eher nicht. Zu viel Intelligenz dahinter, und das merkte man. Oder Elbenita Kajtazi, die hätte auch eine Stimme dafür. Ach, wenn denn die Oper mehr gespielt würde als Traum, der sie ist !
LikeLike
Und endlich einmal wieder eine Premiere ohne Berliner Wokismus
LikeLike
Ein nettes Beispiel des Berliner Woksimus war ja irgendwie, dass die SO einen Pape in aller Öffentlichkeit zwingt, einen Tweet über eine New Yorker Pride-Parade zu widerrufen, das Statement eines bekannten aserbeidjanischen Tenors, der zufällig den Radamès Unter den Linden singt und kurz davor als offizieller aserbeidjanischer Repräsentant sich positiv zu ethnischen Säuberungen äußerte, wie selbstverständlich unbeachtet lässt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Offensive_Aserbaidschans_gegen_Arzach_(September_2023)#Flucht_der_armenischen_Zivilbev%C3%B6lkerung_Arzachs_und_%E2%80%9Eethnische_S%C3%A4uberung%E2%80%9C
https://slippedisc.com/2023/09/exclusive-yusi-eyvazov-calls-for-ethnic-cleansing/
LikeGefällt 1 Person
Man kann verstehn, wenn er die Nase von all dem voll hat.
LikeLike
Die Familie Rattle war auch da und amüsierte sich offenbar gut.
LikeLike