Die neue Aida an der Staatsoper floppt fast, weil sie alles auf einmal will.
Stellenweise überambitioniert, bisweilen hektisch, und auf spielerische Art verweis- und bilderreich ist das, was Calixto Bieito Unter den Linden als Neuinszenierung des Eifersuchtsdramas um die äthiopische Prinzessin, die als Sklavin inkognito am ägyptischen Königshof lebt und in Liebe zu dem zukünftigen Feldherrn Radamès entflammt, präsentiert.
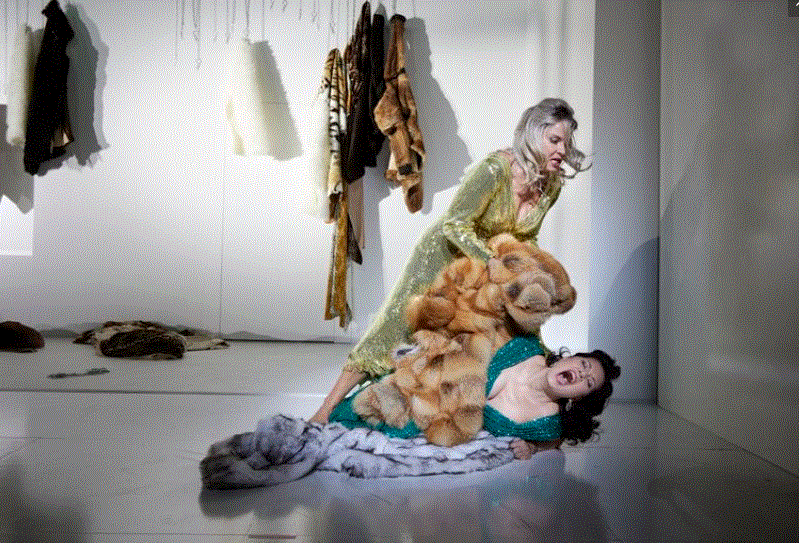
Immerhin ist die Neuproduktion das genaue Gegenteil der saftlosen Antikenmuseum-Story von Pet Halmen. Die hatte 1995 Premiere. Bieito präsentiert ein fröhliches tutti frutti der Deutungsansätze, mischt alles mit allem: viktorianisches Kostüm mit glitzerndem Paillettenfummel (Ingo Krügler, Kostüme), elegant aus Wandnischen herausfahrende, laubbekränzte Vodoofiguren mit dem vermutlich abgedroschensten Requisit des Regietheaters, der Maschinenpistole. Bild schiebt sich über Bild. Weißhäutige Wohlstandskinder sortieren gedankenverloren Elektroschrott. Der äthiopische König Amonasro entspringt zum Duett mit seiner Tochter einem grellweißen Jetztzeitkubus (Bühne Rebecca Ringst). Noch vor dem Vorspiel zum ersten Akt werfen Demonstranten imaginäre Steine gegen das Publikum.
Wieso?
Weil alles eine zweite Ebene hat. Bieito scheint sich angesichts des geradezu unlösbaren Problems einer schlüssigen, allgemeingültigen Aida-Interpretation – Kolonialismus, Kriegszeiten, Kulturenclash – für eine multiperspektivische Herangehensweise entschieden zu haben, die mehr Fragen stellt als Schlüsse zieht.
Radamès erschießt während des Nilduetts drastisch ein Dutzend Kriegsgefangene, aber irgendwie doch nur zum Schein. Sind die Grusel-Clowns Aufpasser oder doch Meta-Figuren, vom findigen Bieito hinzuerfunden?
Bieito hat Verdis drittletzte Oper kolonialisierungspolitisch kontextualisiert und mit konsumkritischem und beflissen flüchtlingsaktuellem Framing versehen. Frech geht anders, aber bieder zeitgemäß geriert sich das auch nicht nur. Weil Bieito die Inhaltsebenen, die in Verdis hochkomplexer Opera in quattro atti und sieben Bildern ohne Zweifel angelegt sind, stets mitdenkt.
Sehr gut, dass Unter den Linden gut gesungen wird.

Als Titelheldin trägt Marina Rebeka (in glitzerndem Türkisgrün) technisch makellos vor, mit astreiner Intonation, bisweilen leicht neutral wirkend, aber in ihren Arien pulst kühles, präzises Sopran-Feuer. EIne herausragende Leistung. Ihre Rivalin Amneris ist eine Liebes- und Machtpolitikerin reinsten Mezzo-Wassers – und bedingungslos Liebende. Dass ihr Sieg – die Enthüllung von Amonasros Intrige – zur Niederlage – die Mitschuld an Radamès‘ Tod – wird, macht sie zur hemmungslos Bereuenden, und Elīna Garanča (im üppigen Pelz) wird dabei zur uneingeschränkten Triumphatorin. Beide Sängerinnen gebieten weder über wirklich italienisches Feuer noch über eine erstklassig klare, italienische Aussprache, vermögen aber dennoch als Vokalistinnen zu glänzen.
Der Radamès (Yusif Eyvazow, mit Camouflage-Beinkleid und Pistole) hat Licht und Schatten. Die Schwärmerei von Celeste Aida (trocken wie Knäckebrot), die Begeisterung von Si, fuggiam (seltsam beteiligungslos) nimmt man dem stimmlich alles andere als zartbesaiteten Krieger keine Sekunde ab, die heroische Trauer der Sterbeszene (La fatal piedra) schon. Tonschönheit ist des Tenors nicht, aber seit einiger Zeit bildet sich bei Eyvazow eine Del-Monaco-Tonschwere heraus, die dem Sänger noch etliche Angebote einbringen wird. Amonasro Gabriele Viviani (mit gefährlich körperlicher Präsenz) zermalmt väterlich kraftvoll das Liebesglück seiner Tochter, während René Pape (gemessen schreitend, mit Oberpriesterschal) dem Ramphis neben erwartbarer klerikaler Autorität eine Dringlichkeit mitgibt, die den Religionsmann weit über das Stereotyp von Verdis Geistlichenfiguren hinaushebt.

Wieselflink und sopranwarm agiert die Priesterin der Victoria Randem, auch während des Balletts, das heuer von fersenschwingenden Putzfrauen mit Türkentaschen absolviert wird. Der Bote ist Gonzalo Quinchahual, der König wirkt wie ein unsympathischer Wiedergänger des Prinzen von Zamunda (Grigory Shkarupa, raumgreifender Bass).
Am Pult gibt Nicola Luisotti alles. Zumindest, wie er es versteht. Zartbesaitet windet sich das Vorspiel, bisweilen zu kräftig, durchaus rasch, spulen die vier Akte ab. Gut der Staatsopernchor.
Heftige Buhs für das Inszenierungsteam, hartnäckige Buhs für Eyvazov, Garanča mit den meisten Bravi, ein hübscher Strauß für Rebeka.
Kurzkritik: Mit dieser Inszenierung kann man trotz Tücken gut leben.

„Floppt fast“? Ach, Herr Schlatz, Sie sind eine gute Seele. Eine bessere als ich. Wäre ich in der Premiere gewesen, ich hätte zum ersten Mal in meiner Laufbahn als Opernbesucher gebuht. Calixto möchte die Stichpunkte einer modernen, werkkritischen Aida abarbeiten (nehme ich an?), aber es fuchteln trotzdem alle nur mit ihren albernen Spielzeugknarren herum. Mein Highlight des Abends, ein glitzernder Hoffnungsstrahl: Eine der roten Junk Food Boxen der Chordamen im Triumphakt verhedderte sich in Elinas Glitzerkleid, sie zog das Ding für ein, zwei Augenblicke hinter sich her. Ich hielt den Atem an, es war herrlich.
LikeLike
Es gibt doch so einen schönen Science-Fiction-Film namens „Der Tag, an dem die Erde stillstand“. Darin spielt Keanu Reeves (der aus „Matrix“) einen Außerirdischen, der ein Vertreter jener Macht ist, die die Erde und ihre Bewohner zerstören will, weil sie überflüssig sind. Bis ihm schließlich ein Wissenschaftler und Mathematiker Klaviermusik von Bach vorspielt, worauf er schließt, es sei besser, diesen Planeten doch nicht zu zerstören.
LikeLike
Ich denk, ich werd mir den Quatsch doch ersparen. Lieber üb ich Variation 28 weiter, die liegt nach 2 Gläsern Wein viel besser in den Fingern. Wirklich. Ist auch kein Wunder, bei den Weinrechnungen, die der Bach hatte.
Var. 29 geht jetzt auch schon ohne gut und flüssig. So, dass es nach Musik klingt.
LikeLike
Meine Lieblings-Fränkin.
LikeLike
Man könnte die Inszenierung noch aktualisieren, obwohl man dann drauf käme, daß sich da unten (womöglich nicht nur da) seit einigen 1000 Jahren eigentlich nicht viel geändert hat :
AMONASRO
Pur rammenti che a noi l’egizio immite,
Le case, i templi, e l’are profanò,
Trasse in ceppi le vergini rapite;
Madri, vecchi, fanciulli ei trucidò.
LikeLike
So langsam werde ich Bieito-Fan.
LikeLike
Wenn ich mir das alles so überdenke, vielleicht gehe ich in die Zweitbesetzung. Magri ist mir schon vor Jahren im Rigoletto positiv aufgefallen, ebenso Margaine. Der Rest ändert nicht viel. Vielleicht kriegt man noch eine billige Karte mit ein bißchen Sichteinschränkung ?
LikeLike
Brauchbare Inszenierung also, im Sinne von Neuenfels ? Am Schluß gewöhnt man sich dran und will sie nach 30 Jahren zurück haben, wenn man sieht, was dann produziert wird ? Früher, bei Neuenfels, da rollten noch die amerikanischen Panzer mit fähnchenschwenkender Besatzung über die Bühne. Hach, waren das noch Zeiten.
LikeLike
KLK schreibt bei Rebeka „nicht immer intonationssicher“ :-))
https://www.rbb-online.de/rbbkultur/themen/musik/rezensionen/buehne/2023/10/staatsoper-unter-den-linden-aida.html
LikeLike
Und Amneris Semenchuk ist in der 2. Vorstellungsserie auch schon wieder raus. Dafür Margaine und die unbekannte Kemoklidze.
LikeLike
Margaine wird nicht übel sein. War die beste Maddalena, die ich gesehn hab.
LikeLike
War interessant, wie die Kommentatorin der Übertragung auf RBB plötzlich betreten schwieg, als der Buhorkan für Eyvazov losging.
LikeLike
Bei der vorlauten Art, die Arie zu singen, kein Wunder.
LikeLike
Und wenn ich auf RBB gehört habe, wie der Viviani im Nilakt forcierte und brüllte, hab‘ ich keinen Impetus, nur wegen Garanca dahinzugehn. Es ist ja kein Samson mit göttlichen 10 Minuten,
LikeLike
Alberne und nichtssagende, abgrundtief hässliche Inszenierung einer der schönsten Operm Verdis.
LikeLike
Was genau, bitte, ist daran schön ? Eigentlich nur eine Phrase, die sich sogleich selbst entlarvt : Pensa, che un popolo, vinto straziato, per te soltanto risorger puo.
LikeLike